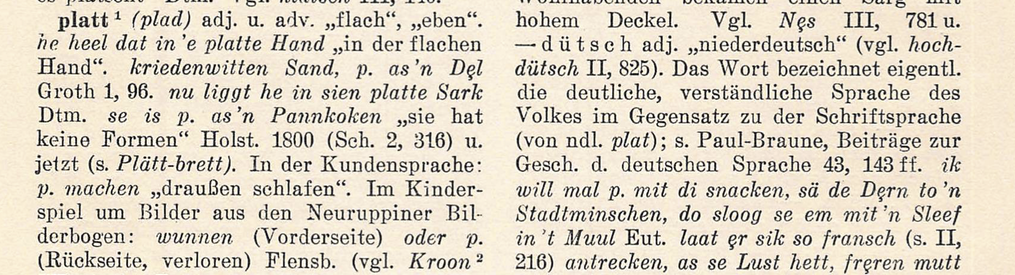Hier kann in’t Wöörbook söcht warrn. Kiek op de Tostands-Siet un dor staht de Wöör vun’t Wöörbook, de all opnaahmen sünd. Dat gifft stüttig mehr Wöör.
(De Utgaav süht noch ni gans so ut as ik se hebben mach. Man dat ward klor, wat dor allns binnen is, wat ji nohstens hier to sehn kriegt.)
In’t Schleswig-Holsteensch Wöörbook sööken:
1 Ergebnis:
Böhn
Fundstelle: Band 1 (A-E), Spalte 476
Anzeige der Originalseite im Wörterbuch
(Link zur Universitätsbibliothek der Universität zu Kiel)
Alternativen
alternative Form/Schreibweise: Bööm
⟶ Nachweis: Angeln
alternative Form/Schreibweise: Bööden
ℹ vereinz
⟶ Nachweis: Süderdithmarschen
⟶ Nachweis: Probstei
⟶ Nachweis: Schleswig
ℹ plural: Böhns
Geschlecht: m
Hochdeutsch: Boden
Erläuterung
ℹ nie:
Hochdeutsch: Erdboden
Allgemeine Anwendung
💬 he leeg op de Eer
Hochdeutsch: am Boden
💬 Wetenland
Hochdeutsch: Weizenboden
ℹ u. dgl
ℹ siehe auch unten bei 2)
Übersetzung/Bedeutung 1
Hochdeutsch: Bodenraum
ℹ der obere, vom Dach und den Bodenbrettern (bezw. Slelen) begrenzte Teil des Hauses, der besonders zur Aufnahme der Erntevorräte dient (Joll - Ang)
Allgemeine Anwendung
💬 dat Hau to Böhn staken
Hochdeutsch: mittels der Forke hinaufschaffen
💬 de Rogg is all to Böhn (bröcht)
Hochdeutsch: die Roggenernte ist schon geborgen
💬 wi hebbt drög Eer to Bühn smeeten
Hochdeutsch: Torf abgeladen
⟶ Nachweis: Stormarn
💬 he stiggt (geit, kladdert) to Böhn
ℹ Aufforderung:
💬 alloh to Böhn!
💬 Böhn an!
Hochdeutsch: geschwind auf den Boden!
⟶ Nachweis: Holstein
Jahresangabe: 1800
Quelle: Sch. 4, 265)
💬 nu geit de Reis los, sä de Papagei, do leep de Katt mit em to Böhn
⟶ Nachweis: Böhns
⟶ Nachweis: Norderdithmarschen
siehe: Bookfink
💬 laat de Welt to Grunn gahn, ik stieg to Böhn
⟶ Nachweis: Kiel und Umgebung
siehe: Backaben
💬 Nawer, stieg to Böhn, ik will neihn
ℹ wenn jemand beim Nähen einen zu langen Faden hat
⟶ Nachweis: Insel Fehmarn
💬 wi stellt dat Huus to (op'n) Böhn un de Ledder in'n Sood
ℹ wenn alle Bewohner ausfliegen und das Haus ohne Aufsicht bleibt
⟶ Nachweis: Herzogtum Lauenburg
💬 ji schulln man lewer en beeten to Böhn forken (staken, bringen)
Hochdeutsch: ihr solltet euch lieber etwas für später aufsparen
ℹ zu Verlobten, die übertrieben zärtlich sind
⟶ Nachweis: Schleswig
siehe: Hill
💬 he hett noch wat op'n Böhn
Hochdeutsch: hat etwas zurückgelegt
⟶ Nachweis: Wilstermarsch
siehe: Oken
💬 he hett een op'n (to) Böhn
Hochdeutsch: ist nicht ganz richtig
⟶ Nachweis: alte Hohnerharde
⟶ Nachweis: Dithmarschen
siehe: Luuk
siehe: Klapp
💬 wat quälst du di üm de Rotten, du hesst ja keen Korn op'n Böhn
⟶ Nachweis: Plön
Jahresangabe: 1850
💬 markst du Müs; Rotten bünd op'n Böhn
Hochdeutsch: merkst du etwas
⟶ Nachweis: Hollingst
Jahresangabe: 1850
💬 ik bün vun hoge Afkunft, sä de Jung, mien Vadder hett op'n Böhn wahnt
💬 wenn wi den Kater man erst op den Böhn hebbt, denn kriegt wi em ok in'n Sack
⟶ Nachweis: Ratzebg
💬 sett een Been op de Eer un een op'n Böhn, un du kannst nix dorbi doon
Hochdeutsch: drehe die Sache, wie du willst, es läßt sich nichts daran ändern
💬 raf Katt, sä Johann Lang, dor smeet he de Kluukheen vun'n Böhn
⟶ Nachweis: Plön
💬 Minsch, wo kriegt wi de Kater vun de Böhn?
Hochdeutsch: wie sollen wir nur das Spiel gewinnen?
ℹ beim Kartenspiel
⟶ Nachweis: Schwabst
💬 sett di op de Eer (bliev op de Eer), denn fällst du ni vun'n Böhn
ℹ zu einem, der zu hoch hinaus will
⟶ Nachweis: Land Oldenburg
Jahresangabe: 1840
⟶ Nachweis: Ostholstein
ℹ von einem solchen Menschen (der hoch hinaus will) sagt man:
💬 he hett Böhnhns in'n Kopp
Hochdeutsch: Hirngespinste
Hochdeutsch: hochtrabende, sonderbare Ideen
⟶ Nachweis: Holstein
Jahresangabe: 1800
Quelle: Sch. 1, 124
⟶ Nachweis: Wilstermarsch
ℹ vgl. oben he hett een op'n Böhn sowie öwerspöhnsch)
💬 he is vun'n Böhn (vun de Hill na de Böhn - Hü) fulln
ℹ Zusatz:
💬 ... un hett all de Haar afbraken
⟶ Nachweis: Holstein
Jahresangabe: 1840
⟶ Nachweis: Hü
Hochdeutsch: er hat sich das Haar schneiden lassen
siehe: Böhnluuk
💬 se lüchtet („hebt") ok nich Peter vun de Böhn
Hochdeutsch: sie mag nichts tun
Hochdeutsch: ist faul
⟶ Nachweis: Angeln
💬 dat is wat vun'n bööwersten Böhn
⟶ Nachweis: Holstein
Jahresangabe: 1840
💬 so wat krüppt (leevt - Kh) ni op de bawerste Böhn
⟶ Nachweis: Westschleswig
ℹ von etwas Außergewöhnlichem
siehe: Boom
ℹ Übung zum Schnellsprechen:
💬 baben op'n bööwelsten Böhn bullert de Wind
⟶ Nachweis: Dänischer Wohld
ℹ Scherz (segg mal ümmer: ik uck):
💬 ik steeg to Böhn Ik uck. Ik nehm'n Brett mit. Ik uck. Ik bohr'n Lock in. Ik uck. Ik scheet un meeg dor dör. Ik uck. Keem'n ol Söög un freet dorvun. Ik ...
⟶ Nachweis: Dänischer Wohld
siehe: Trepp
ℹ Kinderreim:
💬 Hans mien Söhn, stieg op to Böhn un haal mi en Bund Stroh to de ole Koh; de Koh schall mi Melk geben, de Melk will ik de Bäcker geeben, de Bäcker schall mi Stuten geeben, de Stuten will ik de Hund geeben, de Hund de schall mi Hasen fangen, de Hasen will ik in de Schosteen hangen, de Hasen will ik verkopen, dat Geld will ik versupen
⟶ Nachweis: Angeln
Jahresangabe: 1857
ℹ Tanzlied:
💬 hesst du mien Moder ehr Spinnrad ni sehn, dat steit op'n Böhn un hett man een Been, op'n Böhn, op'n Böhn, in de Eck, Eck, Eck
siehe: Spinnrad
Zusammensetzungen
siehe: Achterböhn
siehe: Vörböhn
siehe: Bööwerböhn
siehe: Kornböhn
siehe: Kahlböhn
siehe: Holtböhn
siehe: Törfböhn
Erläuterung
ℹ Als Böhn bezeichnet man auf dem Lande auch die „Stockwerke" in den städtischen Häusern:
💬 he wahnt o'p'n tweten Böhn
⟶ Nachweis: alte Hohnerharde
Erläuterung
ℹ In der Bezeichnung Böhn „Pferdestand", „erhöhte Stelle im Pferdestall" (Ang.) schimmert wohl noch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes durch:
Hochdeutsch: Fläche, die sich über der Grundfläche erhebt
ℹ vgl. hd. „Bühne"
Übersetzung/Bedeutung 2
Hochdeutsch: die Decke eines Zimmers, eines Stockwerks
ℹ ... und überhaupt die nach unten und innen gekehrte Fläche einer Überdachung, z. B. eines Schuppens, Backofens usw
siehe: Born
Allgemeine Anwendung
💬 de Stuuv is man wat sied (hett man twee Meter) ünner den Böhn
ℹ von einem niedrigen Zimmer
💬 wenn dien Fru mal hosten deit, denn flüggst ja ünner'n Böhn
ℹ ... sagt man zu einem kleinen Mann, der eine große, starke Frau hat
⟶ Nachweis: Lütjenburg
💬 he is so groot, he reckt meistto mit'n Kopp an'n Böhn
💬 holt Puust, Hans Sievers, stöt'n Kopp ni an'n Böhn
⟶ Nachweis: Süderdithmarschen
💬 wat de vertellt, dat mutt man gliek mit'n Sacksband an'n Böhn fastnageln
Hochdeutsch: er muß darauf festgenagelt werden
⟶ Nachweis: Schönkirchen b. Kiel
💬 de maakt sik, as wenn he Peermieg an'n Böhn nageln schall
ℹ von einem Mürrischen
⟶ Nachweis: Barmst
Zusammensetzungen
siehe: Rökelböhn
siehe: Windelböhn
Übersetzung/Bedeutung 3
ℹ Als Böhn bezeichnet man auch den „harten Gaumen"
Allgemeine Anwendung
💬 de keen Böhn in den Mund hett, snackt dörch de Nees
⟶ Nachweis: Bargteheide und Umgebung
⟶ Nachweis: Schwansen
💬 he stött mit de Tung an'n Böhn
ℹ vom Stotterer
⟶ Nachweis: alte Hohnerharde
Scherzfragen
ℹ Wortspiel zwischen „Zimmerdecke" und „Gaumen"):
💬 kannst du mit de Tung an'n Böhn licken (recken)?
⟶ Nachweis: alte Hohnerharde
💬 wo geit dat to: ik steek mit'n Messer na'n Böhn rin un kümmt gliek Blaut rut
⟶ Nachweis: Segeberg und Umgebung
Flurnamen
Orts-/Flurname: Böhnhorst
⟶ Nachweis: Schülp
Orts-/Flurname: Böhnhop
⟶ Nachweis: Futterkamp
Orts-/Flurname: Böhnenwisch
⟶ Nachweis: Krogaspe
Zusammensetzungen
siehe: Böhndeeln
siehe: Böhnhaas
siehe: böhnhasen
siehe: böhnhasig
siehe: Böhnholt
siehe: Böhnledder
siehe: Böhnluuk
siehe: Böhnsleten